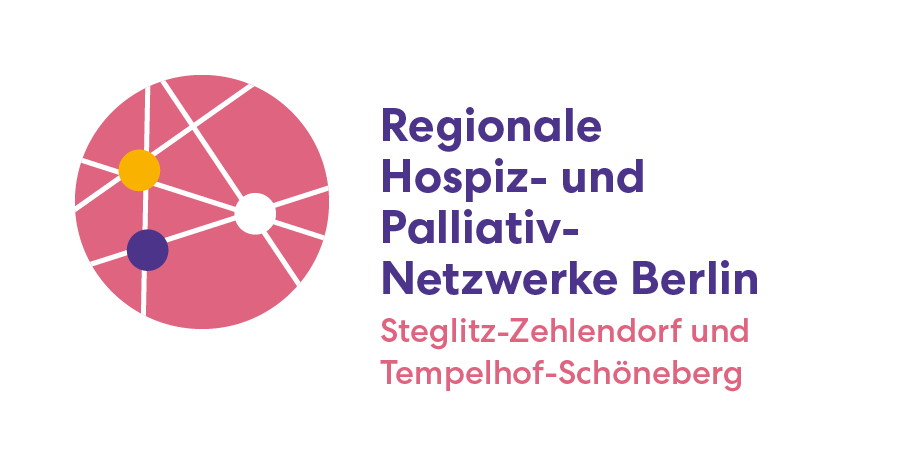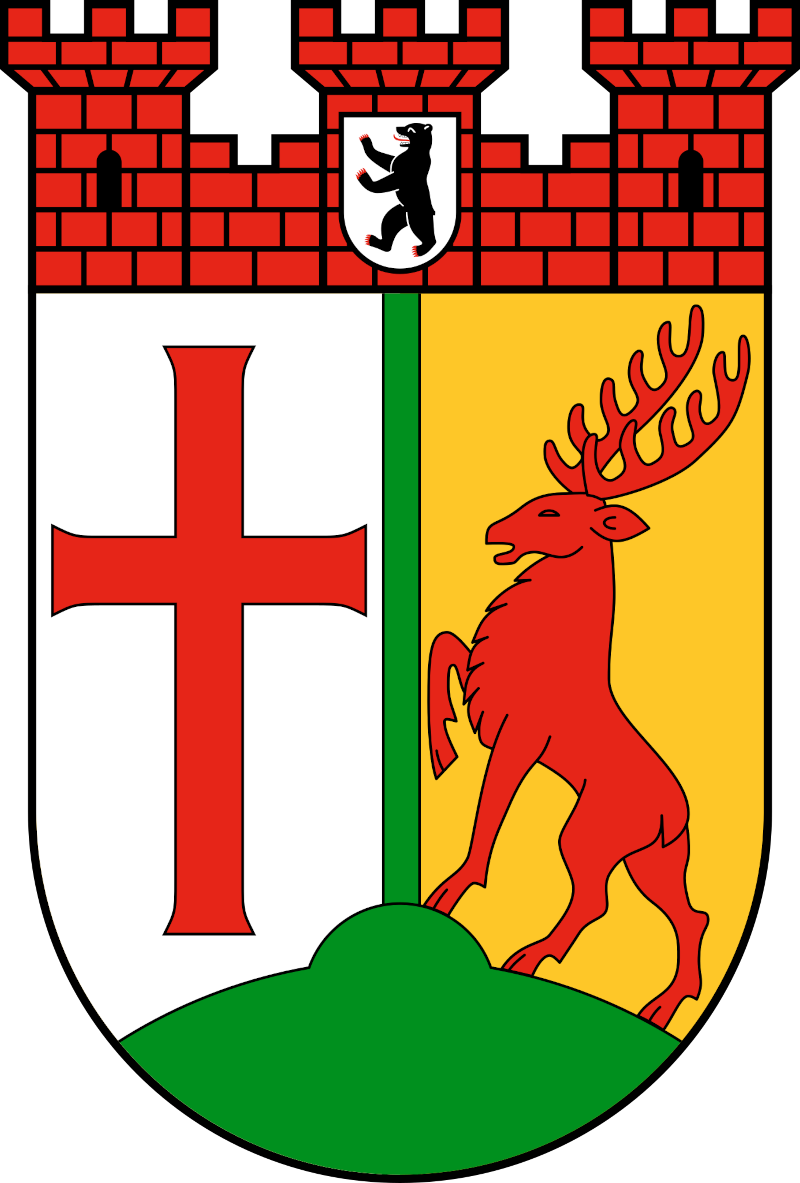Rahmenordnung
für die regionalen Hospiz- und PalliativNetzwerke Berlins
PRÄAMBEL
An der Begleitung, Betreuung und Versorgung in der letzten Lebensphase sind in der Regel unterschiedliche Akteur:innen beteiligt. Gerade an den Schnittstellen zwischen diesen kommt es immer wieder zu Problemen, die sich nachteilig auf die Versorgung der schwersterkrankten Menschen auswirken. Alle an der Versorgung Beteiligten streben eine an den Bedürfnissen und an den Bedarfen orientierte Versorgung an. Dazu gehört vor allem die Erhaltung größtmöglicher Autonomie und Lebensqualität in der letzten Lebensphase. Die besonderen Belange von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit lebensverkürzenden Erkrankungen und deren An- und Zugehörigen sollen entsprechend berücksichtigt werden.
Die wichtigsten Aufgaben der regionalen Hospiz- und PalliativNetzwerke in Berlin sind die Unterstützung aller an der allgemeinen und spezialisierten palliativen und hospizlichen Versorgung beteiligten Akteur:innen in der jeweiligen Netzwerkregion, die bessere Vernetzung und Koordination gemeinsamer Aktivitäten.Dabei sollen bereits existierende Kooperationen mit Care-Management-Bezug gestärkt und vertieft sowie neue Kooperationen angeregt werden. Die Netzwerke in der jeweiligen Region leisten einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Versorgungsstrukturen für schwerstkranke und sterbende Menschen in Berlin. Die Förderung der Koordination nach §39d Absatz 3 SGB V bietet dafür den angemessenen Rahmen.
1. Name, Trägerschaft, Sitz und Geschäftsjahr
Die sechs Netzwerke für das Bundesland Berlin tragen die folgenden Namen:
- „Pankow und Reinickendorf“
- „Charlottenburg-Wilmersdorf und Spandau“
- „Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg“
- „Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg“
- „Neukölln und Treptow-Köpenick“
- „Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg“
Die Trägerschaft aller sechs regionalen Hospiz- und PalliativNetzwerke Berlins übernimmt der
Hospiz- und PalliativVerband Berlin e.V. (HPV Berlin).
Brabanter Straße 21
10713 Berlin
Telefon: 030 41 20 28 75
Fax: 030 41 20 28 76
E-Mail: hpv@hospiz-berlin.de
Der Sitz aller Netzwerke entspricht dem Sitz der Geschäftsstelle.
Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
2. Zweck und Zielsetzung der Netzwerke
In den Netzwerken schließen sich Einzelpersonen und Organisationen zusammen, um die Versorgung von Menschen in der letzten Lebensphase zu verbessern. Um dies zu erreichen, sollen die an der Begleitung, Betreuung und Versorgung Beteiligten nachhaltig und sektorenübergreifend miteinander vernetzt werden. Ehrenamtliche und Angehörige verschiedener Berufsgruppen kommen durch diesen integrativen Ansatz zusammen.
Aus Versorgungsinseln entstehen belastbare Netzwerke und Versorgungsangebote werden damit für schwerstkranke und sterbende in den Netzwerkregionen und berlinweit besser verfügbar.
Durch die Koordination wird eine neutrale inhaltliche Ausrichtung sichergestellt.
3. Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft in den Netzwerken steht grundsätzlich allen allgemeinen und spezialisierten Akteur:innen der Versorgung von schwerstkranken und sterbenden Menschen offen. Die Netzwerke richten sich ausdrücklich an:
- Pflegedienste,
- Stationäre Pflegeeinrichtungen,
- Ärztinnen und Ärzte,
- Krankenhäuser,
- Ambulante (Kinder-) Hospizdienste (§ 39a Absatz 2 Sozialgesetzbuch V),
- (teil)Stationäre (Kinder-) Hospize,
- SAPV-Teams und SAPV-Teams für Kinder und Jugendliche,
- Beraterinnen und Berater der gesundheitlichen Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase nach § 132g Sozialgesetzbuch V,
- Allgemeine bezirkliche oder kirchliche Angebote (zum Beispiel Seelsorge, Trauerbegleitung),
- Ambulante Krebsberatungsstellen nach § 65e Sozialgesetzbuch V.,
die in der jeweiligen Netzwerkregion aktiv sind.
4. Organe und Strukturen der Netzwerke
Die Organe jedes Netzwerks sind die Netzwerkmitglieder, die Netzwerkkoordinatorin / der Netzwerkkoordinator sowie der Träger des Netzwerks.
Die Netzwerkmitglieder sind die Basis jedes regionalen Hospiz- und PalliativNetzwerks in Berlin. Netzwerkmitglied sind alle Organisationen und Einzelpersonen, die eine aktive Mitgliedschaft im Netzwerk haben.
Innerhalb der Netzwerke können sich Mitglieder zu Arbeitsgruppen zusammenschließen. Arbeitsgruppen unterscheiden sich nach Thema und/oder Regionalität (lokal, bezirksweit, gesamtes Netzwerk). Die Mitglieder jeder Arbeitsgruppe wählen eine Gruppenleitung und eine stellvertretende Gruppenleitung. Arbeitsgruppen sind keine formalen Organe der Netzwerke.
Arbeitsgruppen können zusätzlich durch die Netzwerkkoordinatorin / den Netzwerkkoordinator initiiert werden. Diese Gruppen werden durch die Koordinationsstelle geleitet.
Angestellt beim Träger des jeweiligen Netzwerks übernimmt die Netzwerkkoordinatorin / der Netzwerkkoordinator die zentralen Aufgaben, die für die Netzwerkarbeit benötigt werden und in Punkt 5 dieser Rahmenordnung aufgeführt sind. Sie / Er ist Ansprechpartner:in für alle Mitglieder und die Belange der Netzwerke. Die neutrale Ausrichtung der Netzwerke wird durch die Netzwerkkoordinator:innen sichergestellt und gelebt.
Jedes der regionalen Hospiz- und PalliativNetzwerke Berlins hat zusätzlich einen eigenen Qualitätszirkel. Es handelt sich hierbei um eine durch die Netzwerkkoordinatorin / den Netzwerkkoordinator initiierte und geleitete Arbeitsgruppe, die allen Netzwerk-Mitgliedern offensteht.
5. Arbeitsweise, Prozesse, zentrale Aufgaben
Damit belastbare Netzwerke entstehen können, braucht es das Engagement der einzelnen Mitglieder, durch
- die regelmäßige Teilnahme an Terminen,
- die Bereitschaft zur aktiven Beteiligung in Arbeitsgruppen,
- die Bereitstellung von Ressourcen und
- die Bereitstellung und Pflege von Daten in zentraler Datenbank.
Zu den Aufgaben der Netzwerkkoordination gehören insbesondere:
- die Unterstützung der Kooperation der Mitglieder und Koordination ihrer Aktivitäten im Rahmen der Netzwerke,
- die Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeiten und Versorgungsangebote der Mitglieder in enger Abstimmung mit weiteren informierenden lokalen, bezirklichen und berlinweiten Stellen,
- die Initiierung und Koordination von interdisziplinären Fort- und Weiterbildungsangeboten zur Hospiz- und Palliativversorgung,
- die Konzeptualisierung, Organisation und Durchführung von Schulungen zur Netzwerktätigkeit,
- die Organisation regelmäßiger Treffen der Netzwerk-Mitglieder zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Netzwerkstrukturen und zur gezielten Weiterentwicklung der Versorgungsangebote entsprechend dem regionalen Bedarf,
- die Unterstützung von Kooperation der Netzwerk-Mitglieder mit anderen Beratungs- und Betreuungsangeboten, wie Pflegestützpunkten, lokalen Demenznetzwerken, Einrichtungen der Altenhilfe sowie Berliner Behörden und kirchlichen Einrichtungen und
- die Schaffung einer Basis und eines Formates für einen regelmäßigen Austausch von Erfahrungen mit weiteren an der Versorgung beteiligten Akteuren in der Netzwerkregion und Berlinweit.
Die Versorgung und Begleitung bzw. Organisation von einzelnen Versorgungsfällen (Case Management) – im Sinne einer versichertenbezogenen Koordination – findet im Rahmen der Netzwerkkoordination nicht statt.
Jedes der Netzwerke strebt einen kontinuierlichen Prozess der Verbesserung seiner Strukturen, Prozesse und Ergebnisse an. Daher sollen im Rahmen eines internen Qualitätsmanagements diese drei Bereiche mindestens einmal pro Jahr überprüft und ausgewertet werden. Wenn als Ergebnis dieser Auswertungen Empfehlungen für die Anpassung, Ergänzung und Ausweitung von Strukturen, Prozessen und/oder Ergebnissen entstehen sind diese durch den Träger zu bewerten und gegebenenfalls zur Umsetzung freizugeben.
Die Prüfung der Struktur-, der Prozess- und der Ergebnisqualität erfolgt durch einen internen Qualitätszirkel. Der Qualitätszirkel schlägt ein für das regionale Netzwerk passendes Vorgehen bei der Datenaufnahme, der Bewertung und einer geeigneten Form der Ergebnisdokumentation seiner Qualitätsüberprüfung vor. Dem internen Qualitätszirkel bleibt es auch unterjährig vorbehalten Vorschläge zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualitätssicherung zu machen.
Zusätzlich versteht sich die Netzwerkkoordinatorin / der Netzwerkkoordinator als Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und ist dafür verantwortlich, Themen der Qualitätssicherung auch im laufenden Netzwerkgeschehen zu identifizieren, zu dokumentieren und ggf. Vorschläge zur Verbesserung zu formulieren.
6. Anpassung und Ergänzung der Rahmenordnung
Der Träger und die Netzwerkkoordination sind bemüht, im Vorfeld einer Anpassung die Mitglieder mit einzubeziehen.
Wenn es zu einer Anpassung der Rahmenordnung kommt, wird allen Mitgliedern des betroffenen Netzwerks eine Gegenüberstellung der alten und neuen Rahmenordnung digital zugesandt, bevor diese in Kraft tritt, um einen Austausch zu ermöglichen.
Wenn einzelne Netzwerke Ergänzungen zur jeweils geltenden Rahmenordnung wünschen, müssen diese durch den Träger freigegeben werden. Die freigegebenen Ergänzungen werden der Rahmenordnung als Anlage beigefügt.
Stand: 02/2024